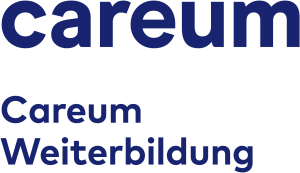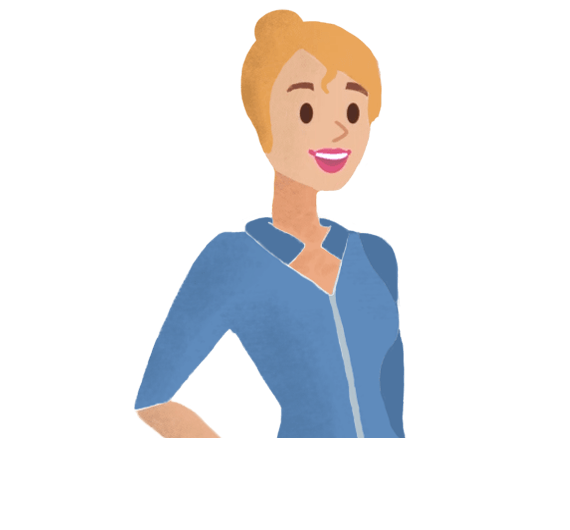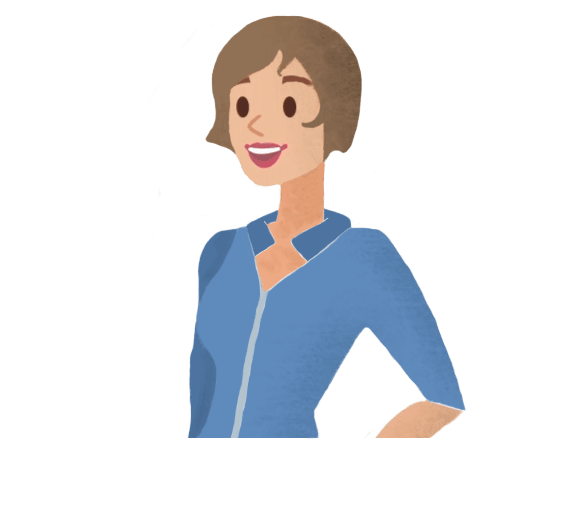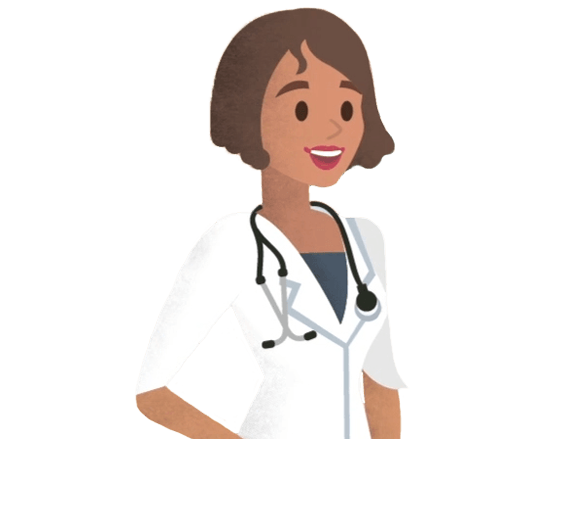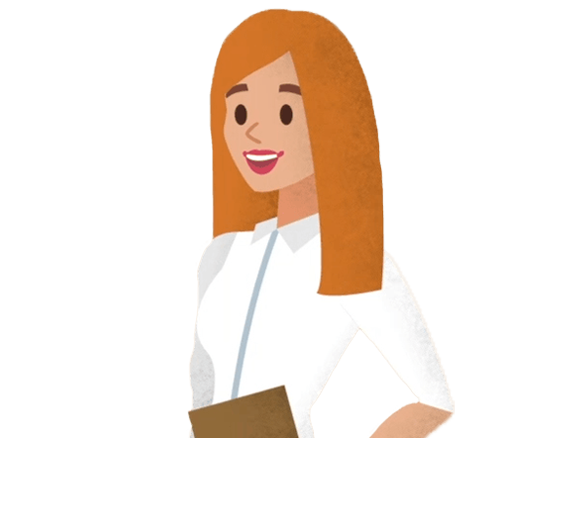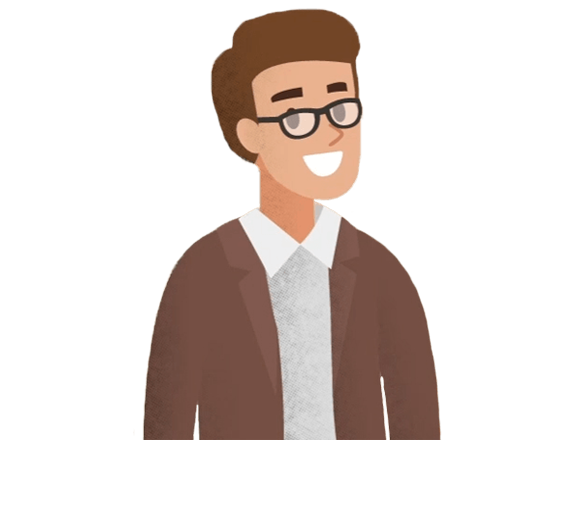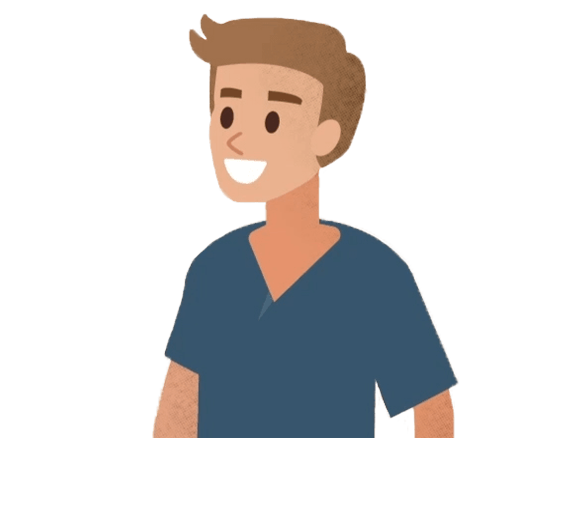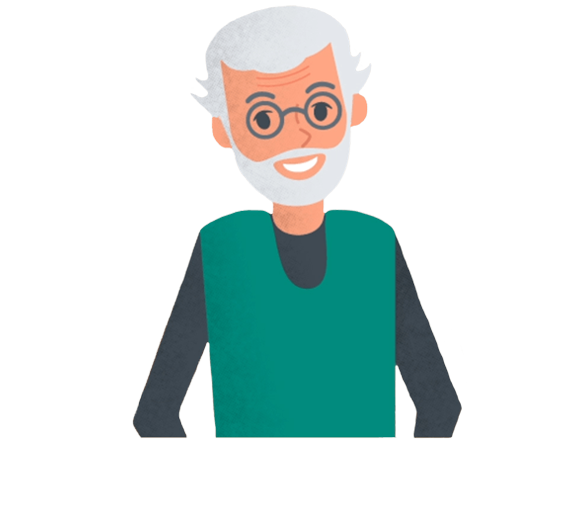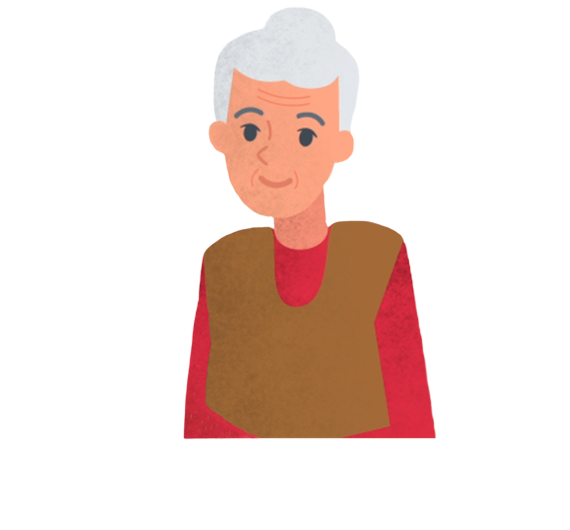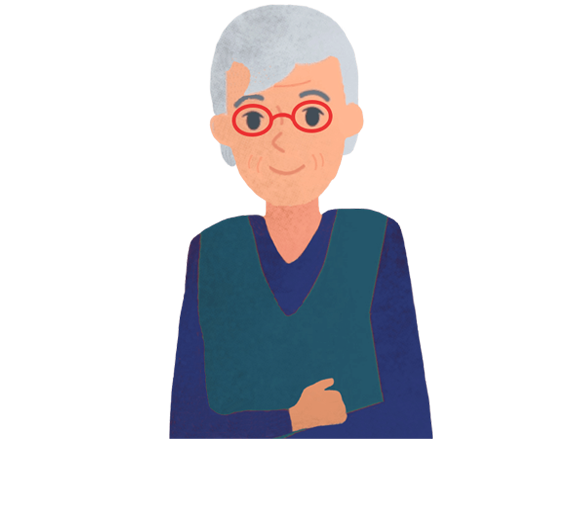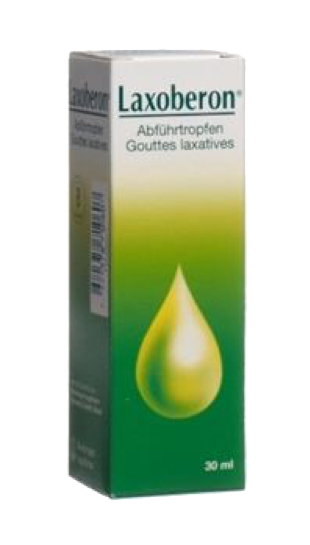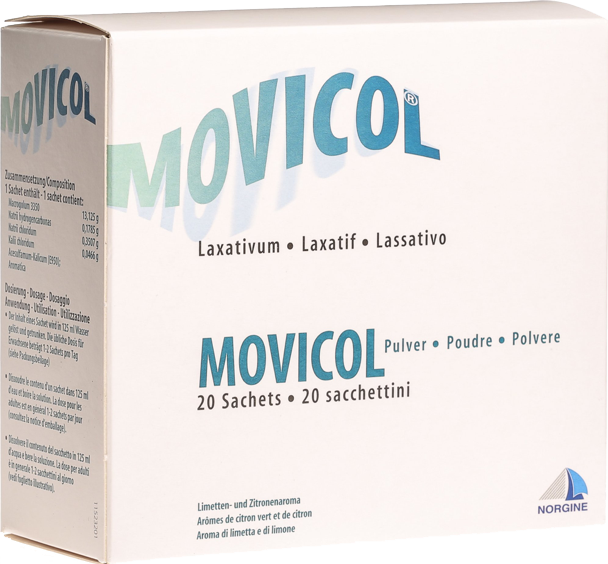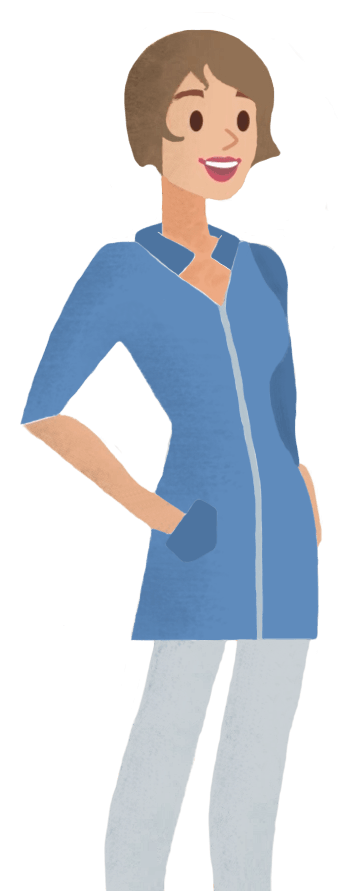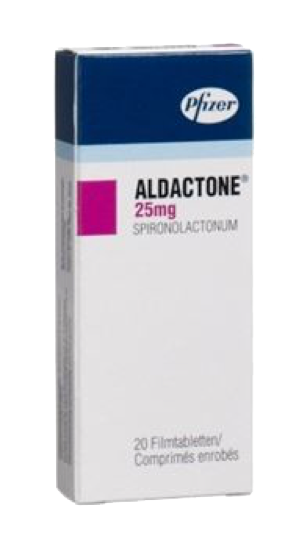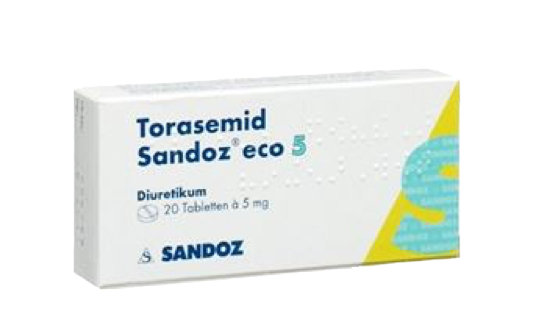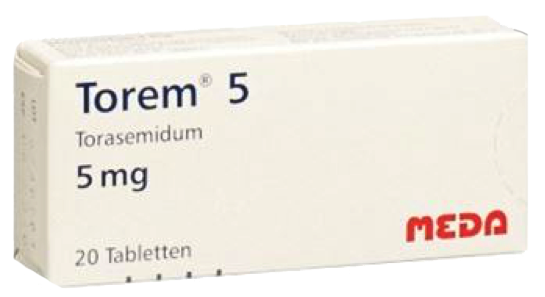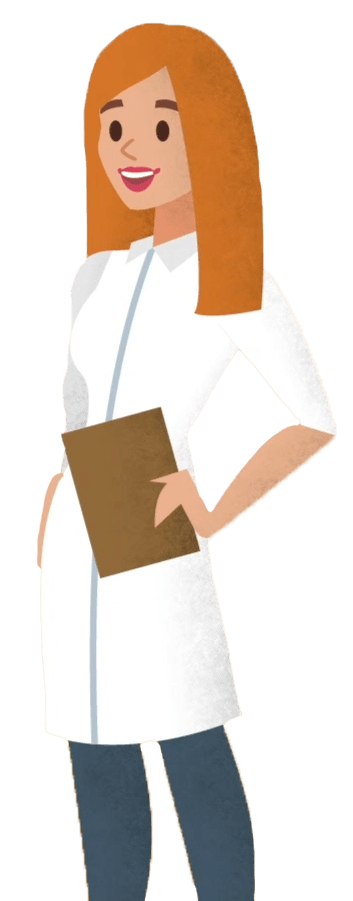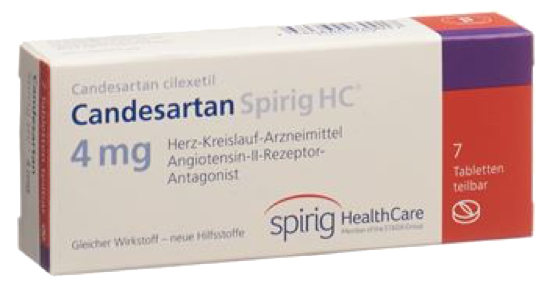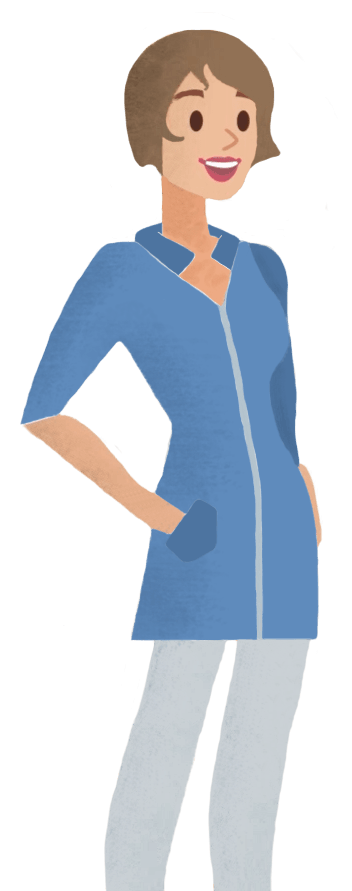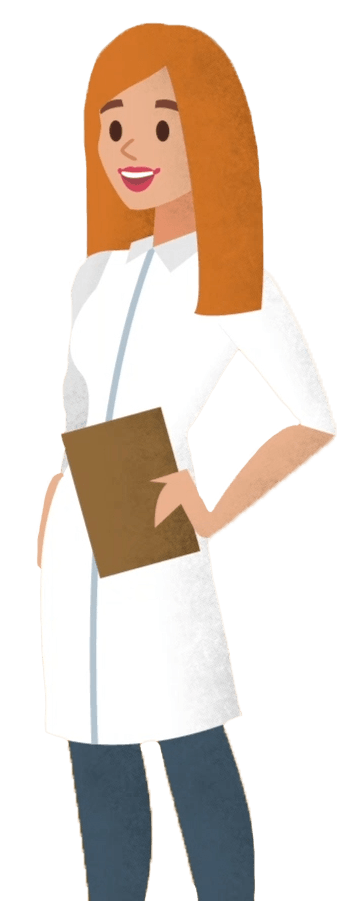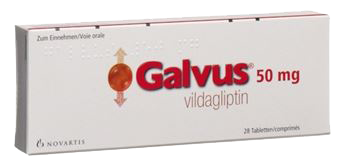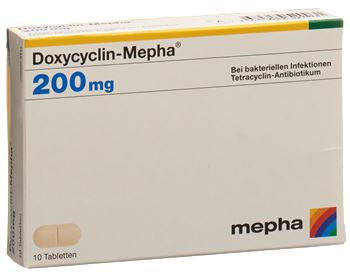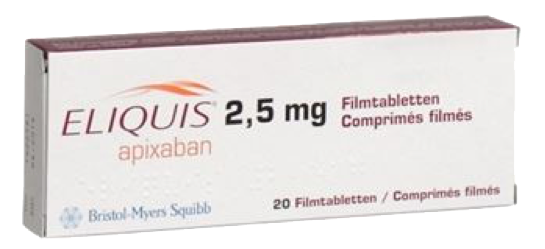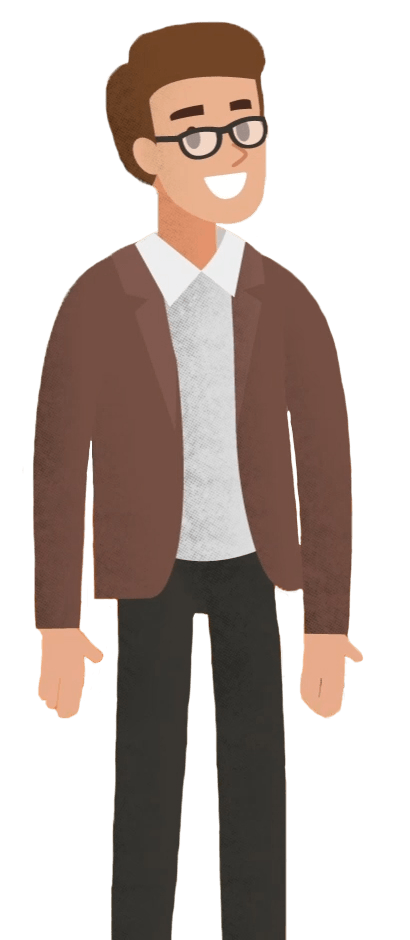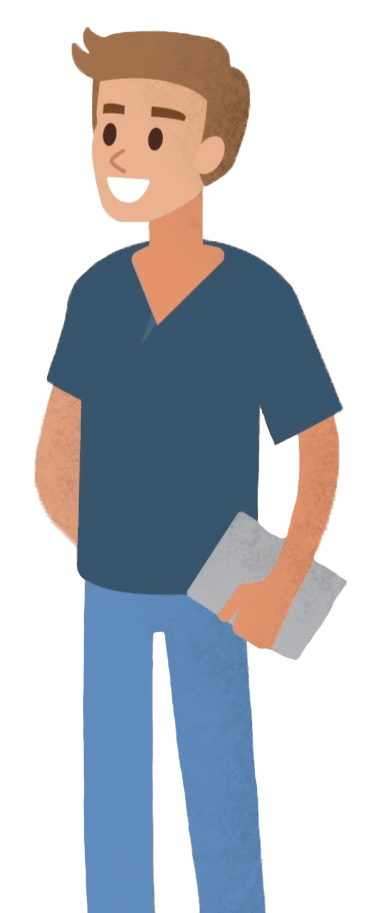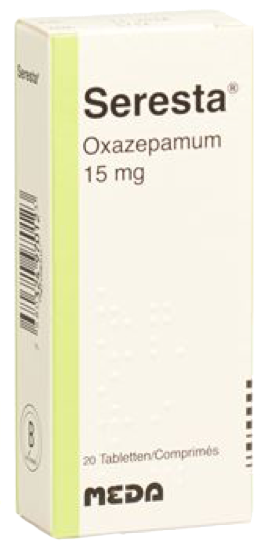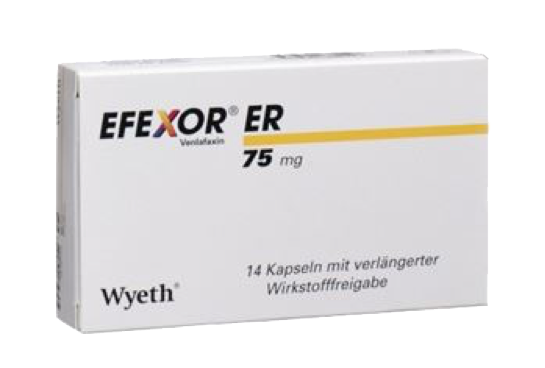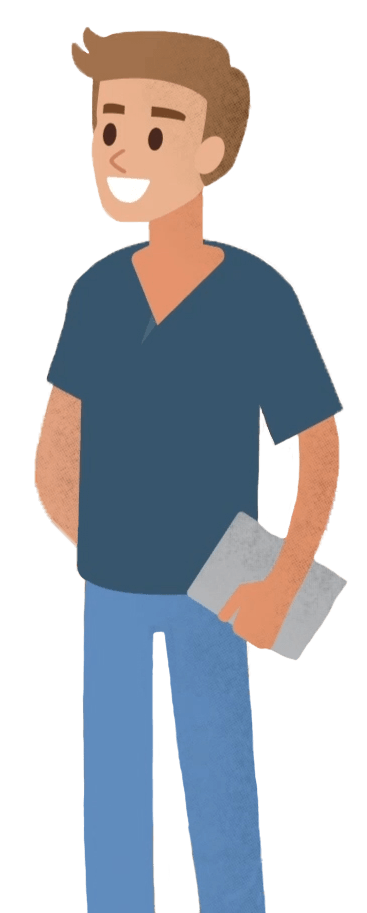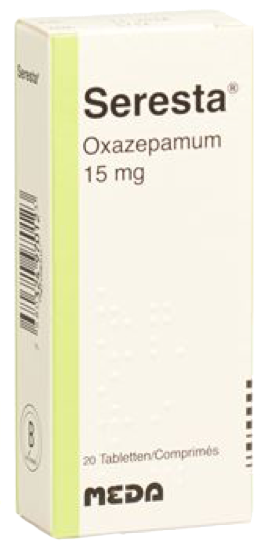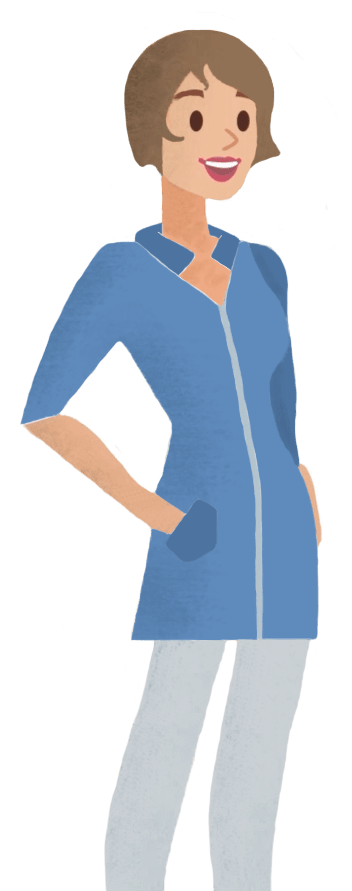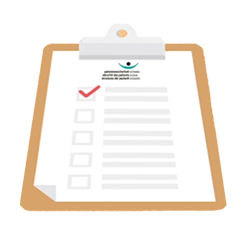American Geriatrics Society 2015 Beers Criteria Update
Expert. American Geriatrics Society 2015 Updated Beers Criteria for Potentially
Inappropriate Medication Use in Older Adults. Vol. Epub ahead, J Am Geriatr
Soc. 2015. p. doi: 10.1111/jgs.13702-.
Bergert FW, Braun M, Ehrenthal K, Feßler J, Gross J, Hüttner U, et al.
Hausärztliche Leitlinie Multimedikation [Internet]. 2014. Available from: https://www.degam.de/files/Inhalte/Leitlinien-Inhalte/Dokumente/DEGAM-S1-Handlungsempfehlung/053-043%20Hausaerztliche%20Leitlinie%20Multimedikation/053-043l_S2e_Multimedikation_2014-05.pdf
Fick DM, Semla TP, Steinman M, Beizer J, Brandt N, Dombrowski R, et al. American Geriatrics Society 2019 Updated AGS Beers
Criteria® for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults. J Am
Geriatr Soc. 2019;67(4):674–94.
Gosman-Hedstrom G, Claesson L,
Blomstrand C, Fagerberg B, Lundgren-Lindquist B. Use and cost of assistive
technology the first year after stroke. A randomized controlled trial. Vol. 18,
International Journal of Technology Assessment in Health Care. 2002. p. 520–7.
Holt S, Schmiedl S, Thürmann PA. Potenziell inadäquate Medikation für
ältere Menschen: Die PRISCUS-Liste. Dtsch Arztebl Int [Internet].
2010;107(31–32):543–51. Available from: http://www.aerzteblatt.de/int/article.asp?id=77776
Kaufmann CP, Tremp R, Hersberger KE, Lampert ML. Inappropriate prescribing: a systematic overview of published
assessment tools. Eur J Clin Pharmacol
[Internet]. 2014;70:1–11. Available from: http://dx.doi.org/10.1007/s00228-013-1575-8
Masnoon N, Shakib S, Kalisch-Ellett
L, Caughey GE. What is polypharmacy? A systematic review of definitions. BMC
Geriatr [Internet]. 2017;17(1):230. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29017448
Musolf M. Mensch und Krankheit im höheren Alter. In: Rehm M, Schwibbe W,
editors. Praxiswissen Geriatrie Ältere Menschen multiprofessionell begleiten.
1st ed. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer; 2019. p. 41–90.
Österreichische Gesellschaft für Geriatrie und Gerontologie. Polypharmazie. Wien: Fakultas; 2016. 114 p.
O’Mahony D, O’Sullivan D, Byrne S,
O’Connor MN, Ryan C, Gallagher P. STOPP/START criteria for potentially
inappropriate prescribing in older people: Version 2. Age Ageing [Internet].
2015;44(2):213–8. Available from:
http://ageing.oxfordjournals.org/content/early/2014/11/18/ageing.afu145.abstract
Pazan F, Weiss C, Wehling M, FORTA.
The FORTA (Fit fOR The Aged) List 2018: Third Version of a Validated Clinical
Tool for Improved Drug Treatment in Older People. Drugs and
Aging. 2019;36(5):481–4.
Swissmedic. Schweizerisches Heilmittelinstitut. Arzneimittelinformation
[Internet]. [cited 2020 Feb 24]. Available from: http://www.swissmedicinfo.ch